Christianshöhe / Lübsche Berge

Diese Anhöhe, von der man einen wunderbaren Panoramablick
auf die Stadt Lübeck hat, hies bis 1809 noch Lübsche
Berge/Barg. Erst als Christian von Hammerstein hier 1809
einen Meierhof anlegen läßt, wird dieser Ort, nach ihm,
dem Zeitgeschmack entsprechend, in "Christianshöhe"
umbenannt. Vermutlich bezog sich der Name ursprünglich
auch nur auf diese Hofanlage und ist erst später auf die
ganze Anhöhe übertragen worden.
1823 heisst es dazu: "Das Vorwerk Christianshöhe ist vor nicht all zu langen Jahren ganz massiv (also in Ziegelsteinen) aufgebaut und bestehet aus einem Haupt- und zwei Nebengebäuden und ist zur Haltung einer Schäferei sehr zweckmäßig."
Zu Christianshöhe gehören 1813: Hof und Garten 1.072
QRth., der Garten an der Heerstraße 60 QRth., der sämtl.
Acker in sechs Schlägen 17.370 QRth. sowie ein Sandberg
mit 60 QRth.. Der Hof Christianshöhe besteht aus einem
Gebäude zwei Herren- und einen Viehhause (52x30 u. 60x24
Fuß) und zwei gleichen Nebengebäuden von 20x30 Fuß.
1828 wird auf Christianshöhe erneut gebaut. So wird eine Rechnung über Steinfahren vom Neuen Hof nach Christianshöhe ausgestellt.
Fuhlenpotts-Krug
Ursprünglich befand sich auf den Lübschen Bergen bis 1751
vermutlich die Kastorfer Allmende (Freiweide), eine Art
Wildnis, größtenteils noch mit Bäumen bestanden, und dem
Fuhlen Pott als Wasserstelle. Genaugenommen handelt es
sich um drei aufeinander folgende Hügel, deshalb "Berge".
Diese Gegend, vor der Verkoppelung noch weit ab vom Dorf
und mit dem steinzeitlichen Grabhügel, war ein idealer
Hintergrund für so manche "Spokergeschichte" (s. Vorgeschichte "Königsgrab").
Durchschnitten wird die Anhöhe durch die ehemalige
Hamburg-Lübecker-Landstraße (s.a. Kastorfer
Zoll). An dieser lag am Fuhlenpott der gleichnamige
Krug. Der Fuhlenpott-Krug ist hier seit 1738 nachzuweisen
und ist vermutlich als Vorgänger zur Kruggerechtigkeit der
Hufe B zu betrachten.
1742 findet in der Nähe dieses Kruges ein Raubüberfall
statt (s. 1742: Raubüberfall beim
Fuhlenpott-Krug). Wie sich aus nachfolgenden Akten
ergibt, war Johann Schnaur hier der Krüger, der auch eine
Landwirtschaft betrieb. Schnauer (auch Schnoor) wurde 1699
in Sühlen bei Oldesloe als Sohn des dortigen Müllers
Hinrich Schnoor geboren. Schnauer wuchs später in der
Bodener Mühle auf und hatte vermutlich bei seinem Vater
das Zimmermannshandwerk gelernt.
1738 hatte Schnauer Streit mit seinen Nachbarn Henrich
Stahmer aus Klinkrade wegen weidenden Viehs und eines
gekauften Pferdes sowie mit dem Siebenbäumer Hufner
Henrich Schmid, wegen dessen angrenzenden Land, genannt
Fernenlands Koppel, das er gepachtet hatte. 1743
kauft er für sich und seine Frau Margarehte
Kirchenstühle in der siebenbäumer Kirche. Er scheint 1751
verstorben zu sein (s. Glockengeld Sbb.), was wohl auch
erklärt, dass die Kruggerechtigkeit auf die Hufe B
übertragen wurde und nun der Hufner Hans Hinrich Meyer
nebenbei einen Krug betreibt. Vielleicht hatte Meyer sogar
die Wittwe Margarethe Schnor 1752 geheiratet, dies läßt
sich mangels Kirchenbücher aber nicht nachweisen.
Wie aus den Verkoppelungsakten hervorgeht, wird der Fuhlenpotts-Orth 1751 der angrenzenden Hufe C zugeschlagen. Vermutlich handelt es sich um den Teich am Hof C direkt an der Landstraße gelegen.
12. Juni 1738 vor dem Steinhorster Amtsgericht
Johann Schnaur von
Castorph contra Henr.
Stahmer von Klinkrade.
Kläger: Er hätte Ihn bekl. eine bey der Castorpher Scheide
belegene Wiese, die Radewiese benahmet, verheuert, und
Sich dabey anheischig gemacht: Selbe in Zauhn zu halten;
Nun aber kähme Er solchen Versprechen nicht nach: daß Er
den Zauhn um die Wiese machte, sondern thäte Ihm vielmehr
mit seinen eigenen Vieh den größten Schaden, worüber Er
gegenwärtigen Hermann
Tretau von Castorph zum Zeugen produciren könte.
Er wolte also gebeten haben: Beklagten dahin anzuhalten:
daß Er seinen Versprechen nachkommen und den Zauhn um die
Wiese machen, auch den Ihm zugefügten Schaden ersetzen
müßte.
Bekl. konte nicht leugnen, Kläger versprochen zu haben:
die dem ehbenst verpachtete Wiese in Zauhn zu erhalten,
und offerirte sich denselben in guten Stand zu stehen auch
den Schaden, welchen sein Vieh Klägern zugefüget, zu
bonificiren.
Hierauf wurde testis [Zeuge] et Arbitrator Hermann Tretau von
Castorph vorgefordert und de _ienda Veritate admonitg
befraget: Wie hoch sich der Kläger von Bekl. Vieh
zugefügte Schade beliefe: Ille, wenn Er die rechte reiner
Wahrheit sagen solte; So könte Er solchen Schaden auf
einen Scheffel Rogken ashimiren.
Bekl. offerirte Sich obigen Arbitio ein genügen zu
leisten, und Kl. auf Martini den Scheffel Rogken zu geben.
Bescheid: Er hätte Bekl. die Wiese versprochener maaßen in
Zauhne zu erhalten, und zu gesetzter frist Klägern den
Scheffel Rogken zu liefern.
Eodem
Idem Schnaur
contra Henr. Stahmer
von Klinkrade
Kläger: Er wäre Ihm Bekl. vor ein verkauftes Pferd 7 Rthl.
schuldig, welche Er von denselben in güte nicht erhalten
könte; Er wolte demnach gebeten haben: Ihm zur Bezahlung
zu verhelfen. Bekl. ignorirte Debitum [Schulden], und
wolte Er Kläger zu seiner Befriedigung aus seine Wiese,
die Radewiese genandt, alljährlich vor 2 Rthl. heu, in
einen solchen Ort, den Kläger sich selbst erwehlen würde,
asigniret(?) haben, und solchergestalt die Schuld tilgen.
Actum Sandesneben den 4ten July 1738
Erschien Henrich Schmid
Hufener zu Siebenbäumen und zeigte an: daß Er an
mitgegenwärtigen Krüger zu Castorph nahmens Johann Schnaur seine an
der Castorpher-Scheide belegene koppel, klein fehren land
[Fernenlandskoppeln] benahmet auf acht nach einander
folgende Jahre solcher gestalt verpachtet hätte: daß
Conductor Johann Schnauer solche Koppel spögig(?)
melioriren , und das darauf stehende Gebüsche ausrotten;
Ihm aber solches Holtz frey laßen, und vor seine Mühe und
angewantde Kosten die elonirte Koppel 6 Jahr frey
genießen, von denen beyden übrigen Jahren ein Jährliches
locarium ad 5 Rthl. bezahlen solle; und weiden ...
1738: Jürgen Malchen [Malchau], Klinkrade (an der Kastorfer Scheide) ./. Joh. Schnaur wegen der Radewische
1738: Joh. Schnaur, Kastorf ./. Johann Löding, Siebenbäumen wegen Forderung
1744: Hans Schnoor wegen Heuergeld
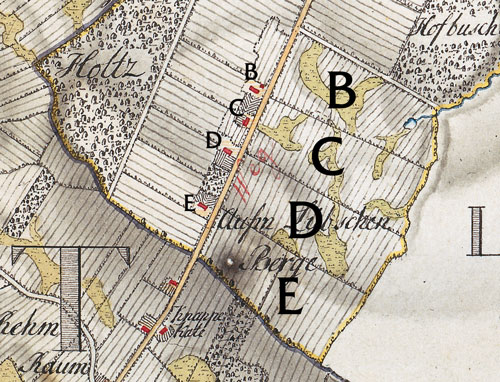
s. auch Hufen B-E

Das Vorwerk "Christianhöhe" auf der Katasterkarte von 1877. Der unterhalb der Hofanlage befindliche Weg führt heute noch auf die Flur "Christianshöhe", vor dem Hofgebäude knickt dann der Kirchstieg nach Siebenbäumen ab (hier "Fußweg"). 1898 läßt Gustav Vorwerk diesen Meierhof, auf dem sich auch eine Meierei befand, niederlegen. Der Tischler Otto Haase bekommt die Genehmigung des Gutsherren das Baumaterial, der schon zum Teil eingefallenen mit Stroh gedeckten Gebäude, verwenden zu dürfen. Die Ziegelsteine und alten Balken verbaut er in seinem neuen Haus an der Hauptstraße 39. Da es sich um alte Steine handelt, musste das Haus verputzt werden, was aber damals für "einen Tischler" nicht als standesgemäß galt.

Familie Haase vor ihrem Haus Hauptstr. 39 um 1910
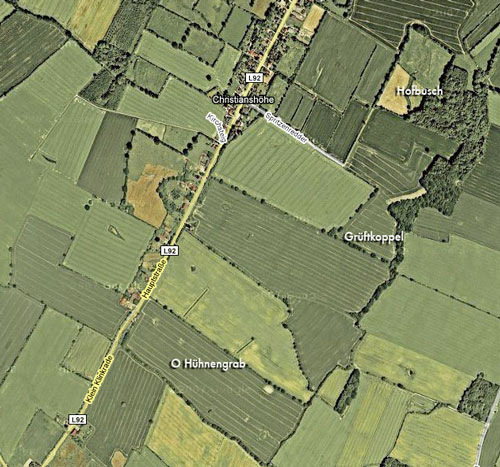
Luftbild von Christianshöhe
2007

Blick von Christianshöhe 1962

Hauptstr. 15, ehemals Klaus Schlanert (vorher Johann
Meinicke, Tischler; Johann Fick), Emma Fürböter

im Hintergrund links
Hauptstr. 6, ehemals Dr. Werner Hoffman, davor Bäckerei
Ernst Bartels (1946-1950), gepachtet von Georg Peters,
dann Bäckerei Schult

Martha Roden im Hintergrund der Hof von Siemer (Hufe B)

Panorama von Christianshöhe
2009: v.l. die Moislinger Hochhäuser, die Marienkirche,
Silo Kronsforde